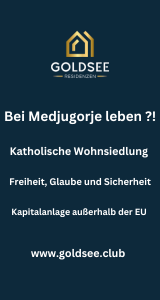SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln: 



Top-15meist-diskutiert- Bischof Voderholzer untersagt Priesterweihen in Zaitzkofen
- Gänswein zum Apostolischen Nuntius für Litauen, Estland und Lettland ernannt!
- Vigano de facto bereits im Schisma
- Deutsche Kirchenstatistik 2023: 20 Mill. 'Katholiken', aber nur 1,26 Mill. besuchen die Hl. Messe
- Game over für BIDEN? - Trump ante portas!
- Frankreich: 105 Priesterweihen im Jahr 2024
- "Als fünffacher Vater mit kleinen Kindern ist das für mich mehr als ärgerlich und nicht akzeptabel"
- Beichtvater von Papst Franziskus gestorben
- Keine Torte für Feier einer ‚Geschlechtsumwandlung’ – christlicher Bäcker erneut vor Gericht
- CDL: Organspende muss freiwillig bleiben – Jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit
- Polen: Exponate über selige Familie Ulma aus Museum über 2. Weltkrieg entfernt
- Wenn "KHG-Katholiken" in Tübingen andere Christen diffamieren
- Vatikan fordert erneut Änderungen beim Synodalen Weg in Deutschland - Schluss mit 'Synodaler Rat'
- Bischof Schneider meint: Viganò im Irrtum, aber er sollte nicht exkommuniziert werden!
- Keine Weihen für Kandidaten einer französischen altrituellen Gemeinschaft
| 
Gottsucherbanden oder Unterhaltungsidioten?16. Juni 2024 in Kommentar, keine Lesermeinung
Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden
Auswege aus der Sackgasse gesellschaftlicher Spaltungen - Gastkommentar von Dr. Michael W. Busch.
Linz (kath.net)
Natürlich ist die polemische, auf den Kunsttheoretiker Bazon Brock zurückgehende Unterteilung des modernen Menschen in Gottsucherbanden und Unterhaltungsidioten stark vereinfachend, denn jeder Mensch ist immer Sinnsucher und Lustmaximierer zugleich, trägt spirituelle wie materiell-hedonistische Strebungen in sich. Und doch hat Brock mit der Benennung dieser Idealtypen irgendwie einen Nerv getroffen, der einen zum Nach- und Überdenken der eigenen Position anzuregen vermag.
Überhaupt liegt der Hang, Menschen in solche und solche, Insider und Outsider, Dazugehörige und Außenseiter, Böse und Gute, Gläubige und Ungläubige zu unterteilen, offenbar in der menschlichen Natur angelegt und das hat gewiss auch seine stichhaltigen Gründe. Dennoch stellt Jesus die auch heute noch vielen unzumutbar, ja töricht erscheinende Forderung auf, denen, die uns Böses tun, Gutes zu tun, und die, die uns fluchen, zu segnen (Mt. 5, 43-44) – vermutlich deshalb, um nicht am Ende genauso zu werden, wie die Gegenseite, denn der, der mit Steinen wirft, wird schließlich selber zu Stein, wie es der Lyriker Reiner Kunze einmal ausgedrückt hat; er verhärtet, wird kalt, unempfindlich und rücksichtslos. Das galt auch für Saulus, den eifernden Christenverfolger, der den ersten Märtyrer der Kirche – Stephanus – steinigte, nach seiner Bekehrung aber sein Leben wandelte und zum Völkerapostel Paulus wurde.
Dieses Beispiel zeigt, dass der Mensch immer alle Veranlagungen in sich trägt, sich vom Bösen zum Guten und umgekehrt wandeln kann, wobei der jeweilige Verhärtungsgrad, die Tiefenverwurzelung der Denk- und Verhaltensgewohnheiten – eingeübte, über Jahre praktizierte Tugenden oder Laster – sicherlich Einfluss darauf nehmen, wie schwer oder leicht ein Wechsel vollzogen werden kann. Fest steht aber, dass jegliches Urteilen in reinen Gegensätzen eine holzschnittartige Verkürzung der Komplexität menschlichen Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns darstellt. Der Mensch weist zahlreiche Schattierungen und Nuancen auf, ist eben nicht rein binär codiert. Er fühlt immer Vieles gleichzeitig in sich, oft auch Widersprüchliches, ist aus Fleisch und Blut, simuliert also nicht einseitig und gezielt Gefühle, wie es die künstliche Intelligenz macht (nebenbei bemerkt: auch Psychopathen sind Meister darin, Gefühle zu schauspielern, um ihre Mitmenschen in eine bestimmte, meist eigennützige Richtung zu lenken – eine zufällige Parallele zur KI?).
In unserer Gesellschaft hat sich eine wirklich ungute Entwicklung aufgetan. Es wird immer mehr gespalten, gehetzt, verspottet, diffamiert, kleingemacht. Politische Diskussionen im Fernsehen schaue ich mir schon seit Jahren nicht mehr an, denn hier wird kein echter Dialog geführt, in dem auf die Argumente des Gegenübers eingegangen wird, sondern die Teilnehmer schlagen sich mit Worten nur gegenseitig die Köpfe ein, wiederholen schematisch ihre altbekannten Positionen, um damit die notwendige Aufmerksamkeit zu erzeugen, Emotionen genügend hochzupeitschen und am Ende die gewünschte Einschaltquote herzustellen bzw. die benötigten Wählerstimmen zu gewinnen. Auch im Netz tobt dieser reißerische Kampf um Klicks (clickbaiting). In Beiträgen auf LinkedIn werden beispielsweise Chefs entweder zu toxischen Ungeheuern verdammt oder zu empathisch wertschätzenden Überfiguren verklärt. Was zunehmend verloren geht, sind die Zwischentöne, also das, was im Grunde das Leben ausmacht, das nur selten im reinen Schwarz oder reinen Weiß stattfindet.
Spaltungserscheinungen
Wir sollten unbedingt weg von diesen Entweder-Oder-Darstellungen kommen. Unterteilt man Diskussionen in „logisch – ideologisch – idiotisch“, so findet der Austausch, vor allem in den öffentlichen Medien, teilweise auch im privaten Kontext, heute leider zunehmend in den beiden letztgenannten Bereichen statt. Kaum ein umstrittenes Thema wird noch ergebnisoffen, nüchtern und sachlich, geschweige denn mit Humor und Gelassenheit erörtert, nur selten werden einzelne Facetten ausführlich beleuchtet und kritisch im Hinblick auf ihr Für und Wider abgewogen. Jeder verfügt bereits über die in seiner jeweiligen Echokammer entwickelte, fortlaufend durch Gleichgesinnte verstärkte, vorgefertigte, ja betonierte Meinung, die nach außen mit aller Vehemenz vertreten wird. Schließlich denken ja alle in der eigenen virtuellen Community so, also muss es wohl stimmen.
Die anderen sind wahlweise Schlafschafe, Querdenker, Schwurbler oder schlicht Nazis. Wie Kampfhähne gehen die Diskutanten aufeinander los, wie trotzige Kinder sind sie sofort beleidigt und empört, in ihrem Stolz gekränkt, wenn ihnen nicht umgehend recht gegeben oder noch schlimmer: ihnen gar widersprochen wird; sie fangen an, laut zu werden, zetern, werden ausfällig und gehen, sobald auf der Sachebene eine argumentative Niederlage droht, in den persönlichen Angriff über.
Mir geht das heutige Deutschland mit seiner Debatten-Unkultur, seinen hysterisierten, ideologiegetriebenen Nebelkerzen-Diskussionen unter Ausblendung gesamtgesellschaftlicher Kernprobleme und Zukunftsfragen mächtig „auf den Zeiger“ – die Rechten mit ihrer Rechthaberei und Nationaltümelei, ihrem Fremden- und oft auch Kirchenhass UND die Linken mit ihrer Hypermoral, ihrer Realitätsverleugnung, zumindest aber Zurechtbiegung („es kann nicht sein, was nicht sein darf“), ihrer ab- und ausgrenzenden Selbstverklärung: Da die ach so bösen Rechten, hier wir, die Guten, die toleranten und vielfältigen LGBTQIA+-Jünger*innen, deren Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Abweichlern allerdings nicht weit entfernt ist von der Toleranz der Kommunisten gegenüber Dissidenten, nur dass heute Gott sei Dank noch niemand im Archipel GULAG landet; für Shitstorms, die mediale Hinrichtung und Stigmatisierung, d.h. die Zerstörung des öffentlichen Rufs, aber auch den Entzug der Lebensgrundlage durch Entlassung aus Weltanschauungsgründen reicht es aber oft schon.
Das Denunziantentum feiert Urstände in unseren Tagen, obwohl der Denunziant bekanntlich der „schlimmste Mann im ganzen Land“ ist; es gibt immer eine undichte Stelle, eine Petze, einen „Zwitscherer“ – häufig aus den eigenen Reihen –, der einen „verpfeift“ (so wie zuletzt bei Papst Franziskus‘ „Schwuchtel-Sager“). Welche Motive diese Wasserträger dabei leiten – Geltungs- oder Rachsucht, eigene Minderwertigkeitsgefühle und daraus resultierender Neid – wäre sicherlich einer genaueren Prüfung wert.
Wir haben uns in ideologische Sackgassen manövriert, in nur teilsolidarische, dialogunfähige Weltanschauungszirkel fraktioniert. Zwar wird allerorten in öffentlichen Verlautbarungen von Wertschätzung, Solidarität, Inklusion oder Diversität gesprochen, doch das, was gefordert, und das, was tatsächlich gelebt wird, klafft immer weiter auseinander. Wie soll man aber all die heutigen Missstände noch offen anprangern können, wenn hinter jeder Ecke die Gegenseite nur darauf lauert, dass man vermeintlich „justiziables Material“ von sich gibt, und man als Übeltäter, bevor man, wenn überhaupt, vor Gericht gezogen wird, zuvor in einem öffentlichkeitswirksamen Schauprozess durch selbsternannte, doch anonym bleiben wollende Sitten- und Diskurspolizisten (aus)gerichtet wird („ausgerichtet“ im österreichischen Sinne des Wortes, das heißt schlechtgeredet und heruntergemacht)?
Wie soll man heute noch einen vertrauensvollen, offenen Dialog führen, wenn das Gesprächsklima durch gegenseitigen Argwohn derart vergiftet ist? Schon Benedikt XVI. klagte über die „sprungbereite Feindseligkeit“ der Medien. Man denke zurück an die Reaktionen auf seine 2006 gehaltene Regensburger Rede, die inzwischen als prophetisch eingestuft werden kann. Digital Detox, das bewusste Abschalten von Medien, das Handyfasten und der Retreat ins Analoge, die gezielt genommene Auszeit, werden nicht ohne Grund als aktuelle Gegentrends ständiger Erreichbarkeit, ständigen Kommentieren- und Liken-Müssens diskutiert, um wieder fokussiert arbeiten und klar denken zu können, um innerlich zur Ruhe zu gelangen und Vernunft anzunehmen. Die Stille ist der Arbeitsplatz Gottes, hier führt er den Menschen wieder in seine Mitte, richtet ihn auf das Wesentliche aus.
Spaltungsgründe
Woher kommen all die unseligen Kategorisierungstendenzen? Neben dem Aufkommen sozialer Medien werden sie in unseren Umbruchzeiten sicher durch Abstiegsängste der Mittelschicht angefeuert, die zu Aggressionen führen, denn Angst und Aggression hängen eng miteinander zusammen. Nicht zuletzt bildet die „transzendentale Obdachlosigkeit“ (Georg Lukács) ein wesentliches Erklärungselement, denn welches gemeinsame Band hält unsere Gesellschaft noch zusammen, wenn Gott von vielen, wenn nicht aktiv für tot erklärt, so doch passiv schlicht ignoriert oder vergessen wird, wenn überdies die Nation als verbindende Idee ramponiert ist und in einem multikulturellen Kontext sowieso kaum mehr sinnvoll erscheint (womit allerdings nicht die Aufgabe von Traditionen, des kulturellen Erbes gemeint ist, denn wer keine Herkunft hat, hat nach Odo Marquard keine Zukunft)?
Selbstverwirklichung und Selbstbehauptung sind im darwinistischen Kampf um Geld und Geltung zu dominanten Verhaltensmustern geworden. Empathisch ist man nur noch auf eine kalte, den anderen durchschauende und beeinflussende Weise, um ihn für eigene Zwecke einspannen zu können. Um die Verzichtbereitschaft für das größere Ganze ist es daher schlecht bestellt. Warum soll ich auf etwas verzichten, wenn es die anderen auch nicht tun und „die da oben“ am allerwenigsten? In den 1980er-Jahren gab es den Spruch: Alle denken nur an sich, nur ich, ich denke an mich.
Heute ist dieser Spruch in weiten Teilen Wirklichkeit geworden, wenn es auch immer rühmliche Ausnahmen der Selbstaufopferung und Hilfsbereitschaft gibt. Auch das muss gesagt werden. Die Schubladisierung von Menschen ist allgemein immer leichter, als sich mit der persönlichen Geschichte und Sichtweise einzelner Menschen oder gar der eigenen Prägung ernsthaft auseinanderzusetzen. Die Abwertung des Gegenübers rechtfertigt das eigene Handeln, stellt es nicht in Frage. Das Problem wird auf die andere Seite verlagert. Man selbst bleibt von der kritischen Betrachtung ausgenommen, schließlich ist Selbstbeurteilung um einges mühsamer als Fremdverurteilung.
Aus der systemischen Beratung wissen wir aber, dass innerhalb eines Beziehungsgeflechts jeder immer Teil des Problems, wie auch Teil einer zu entwickelnden Lösung ist und ergo nicht nur der Einzelne, sondern stets das ganze soziale Gefüge betrachtet werden muss. Seelisch kranke Menschen haben nicht selten auch kranke Beziehungen, gesunde Menschen entwickeln stabile, Sinn und Glück vermittelnde Beziehungen. Sich selbst auszuklammern und aus der Affäre stehlen zu wollen, greift demnach zu kurz. Bei Streitigkeiten ist nie nur eine Seite beteiligt. It takes two to tango. 
Ein wahrhaftiges Bild vom Menschen entwickeln
Denjenigen, die Menschen in gut oder schlecht, gläubig oder ungläubig, rechts oder links einteilen, die implizit immer die einen als Menschen, die anderen im Sinne der „Dehumanisierung“ (Zygmunt Bauman) als Unwesen erscheinen lassen, die also zur Spaltung der Gesellschaft beitragen oder aber sich von Kräften im Hintergrund dazu verführen lassen, dieser Spaltung zu folgen (denn durch Spaltung und Angst kann eine Gesellschaft leichter manipuliert und beherrscht werden; die größere Blockbildung wird erschwert, da die Menschen angestrengt damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu bekämpfen), sei dringend die Lektüre des Buchs „… trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“ von Viktor E. Frankl empfohlen, das 1946 erstveröffentlicht wurde.
Zweifellos wird uns mit diesem Buch eine äußerst bittere Medizin verabreicht, die zu nehmen ich lange gezögert habe, doch entwickelt die Medizin eine heilsame Wirkung, indem sie unseren gewöhnlichen Blick auf das Leben und den Menschen radikal verändert. Darin schreibt Frankl gegen Ende: „Mit der Kennzeichnung eines Menschen als Angehörigen der Lagerwache oder, umgekehrt, als Lagerhäftling ist nicht das geringste gesagt. Menschliche Güte kann man bei allen Menschen finden, sie findet sich also auch bei der Gruppe, deren pauschale Verurteilung doch gewiss sehr nahe liegt. Es überschneiden sich eben die Grenzen! So einfach dürfen wir es uns nicht machen, dass wir erklären: die einen sind Engel und die andern sind Teufel.
Im Gegenteil: entgegen der allgemeinen Suggestion, (…) als Wachtposten oder Aufseher den Häftlingen gegenüber menschlich zu sein, ist und bleibt irgendwie eine persönliche und moralische Leistung; andererseits ist die Niedertracht eines Häftlings, der seinen eigenen Leidensgenossen Übles antut, besonders verwerflich. Dass die Charakterlosigkeit eines solchen Menschen die Lagerhäftlinge besonders schmerzt, ist ebenso klar wie andererseits die tiefe Erschütterung, mit der ein Häftling die geringste Menschlichkeit entgegennimmt, die ihm etwa von einem Wachtposten erwiesen wird (…) Aus all dem können wir lernen: es gibt auf Erden zwei Menschenrassen, aber auch nur diese beiden: die »Rasse« der anständigen Menschen und die der unanständigen Menschen.
Und beide »Rassen« sind allgemein verbreitet: in alle Gruppen dringen sie ein und sickern sie durch; keine Gruppe besteht ausschließlich aus anständigen und ausschließlich aus unanständigen Menschen (…) Das Leben im Konzentrationslager ließ zweifelsohne einen Abgrund in die äußersten Tiefen des Menschen aufbrechen. Soll es uns da wundern, dass in diesen Tiefen auch wieder nur das Menschliche sichtbar wird? Das Menschliche als das, was es ist –, als eine Legierung von gut und böse! Der Riss, der durch alle Menschen hindurchgeht und zwischen gut und böse scheidet, reicht auch noch bis in die tiefsten Tiefen“ (S. 129 f., Kösel-Verlag, Neuausgabe 2009).
Wir können in unserer Gesellschaft nur dann wieder mit Hoffnung in die Zukunft schreiten, wenn wir wegkommen von den unnötigen Spaltungen, den gegenseitigen Anfeindungen und dem mehr als kleinlichen, weil häufig reiner Profit- und Postengier entspringenden parteipolitischen Gezänk. Was ist an der Abkanzelung eines grünen österreichischen Vizekanzlers gegenüber einer journalistisch gründlich recherchierten Geschichte als „anonymes Gemurkse und Gefurze“ besser als an den aufhetzenden Reden eines Trump oder Kickl? An dem Spruch, der im Internet offenbar fälschlich George Orwell zugeschrieben wurde, ist schon einiges dran: Unabhängige Zeitungen müssen schreiben, was Politiker nicht lesen wollen. Alles andere ist Propaganda (oder Public Relations, wie dieses Phänomen heute verschleiernd genannt wird).
Die 1970er und 80er Jahre waren irgendwie noch ehrlicher, politisch inkorrekter, authentischer; die Menschen waren natürlicher, weniger gekünstelt, nicht derart selbstinszenierend und -verherrlichend. Der Personal Branding-Zirkus, das heißt die Selbstvermarktung, die öffentliche Darstellung des eigenen Ich zu Verwertungszwecken, war noch kein Massenphänomen. Die meisten haben einfach ihre Arbeit gemacht, sind ihren Pflichten nachgegangen, ohne dabei übertrieben zu jammern oder normale Leistungen zu Höchstleistungen hochzujubeln. Heute neigen viele dazu, sich entweder als Opfer der Umstände oder als Helden, als unumstößliche Meister ihres Geschicks zu stilisieren.
Wir sollten uns wieder mehr als Menschen sehen, als Wesen mit Stärken und Schwächen, schönen und weniger schönen Seiten, die zudem gute und schlechte Tage haben. Vor allem müssen wir weg von dem gefährlichen, ob real oder mit Worten praktizierten: „Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir den Schädel ein“. Realismus und Wahrhaftigkeit sind gefragt, nicht das Leben in Scheinwelten, in den Filterblasen sozialer Medien, in denen narzisstische Selbstbeweihräucherung und verzerrte Informationsaufnahme (false balance) an der Tagesordnung stehen, die zur mentalen Umnachtung ihrer Bewohner beitragen.
Maßnahmen zur Überwindung von Spaltung
Doch was können wir gegen diese dominanten Spaltungstendenzen tun? Wie schaffen wir es aus dem Entweder-Oder-Denken, dem an Einzelinteressen ausgerichteten Partikularismus wieder heraus? Von heute auf morgen geht es sicherlich nicht. Kritisches Denken, Mediennutzungskompetenz (digital literacy), Geschichtskenntnisse, Allgemeinbildung, die stete Vergegenwärtigung menschlicher Grundrechte und besonders die Kunst der Selbstbescheidung bilden zunächst die Basis. Sodann sollten wir uns um „verbale Abrüstung“ (Thomas Klestil) bemühen, der Verrohung der Sprache bei uns selbst entgegenwirken, dabei aber auch nicht unehrlich Dinge beschönigen.
Wenn ein Ausländer eine Kriminaltat begangen hat, dann hat er sie begangen. Wenn eine Kriminalitätsstatistik hinsichtlich bestimmter Bevölkerungsgruppen eine eindeutige Sprache spricht (sofern überhaupt noch eine solch differenzierte Erfassung erfolgt), dann spricht sie diese Sprache und das darf nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden, sonst setzt sich dieser irgendwann in Bewegung und bringt den Boden, auf dem wir stehen, zum Schwanken. Über die hinter bösen Taten steckende Gründe und sinnvolle Gegenmaßnahmen lässt sich im Anschluss immer noch genauer nachdenken. Als erstes gehören aber einmal sämtliche Fakten ungeschminkt auf den Tisch gelegt. Jedes Change Management in Unternehmen beginnt nach John P. Kotter in der ersten Phase mit der ungeschönten Analyse der eigenen Wettbewerbsposition und der Entwicklung eines Gefühls der Dringlichkeit (sense of urgency). Erst wenn diese Phase abgeschlossen, also definitiv in den Köpfen der (Schlüssel)Beteiligten angekommen ist, kann es an die Planung und Umsetzung des Wandels, an konkrete Veränderungsschritte gehen.
Als nächstes sollten wir wirkliche Toleranz lernen, nicht nur exklusive bzw. exkludierende Toleranz: Rechte und Linke sind Menschen, die eine Geschichte haben, die ihre Verletzungen und Ängste in sich tragen, deren Beweggründe für ihr Denken und Handeln es anzuhören gilt. Wenn wir es nicht schaffen, wieder unaufgeregt dialog- und zuhörfähig zu werden, dann endet der abgebrochene Diskurs am Ende in offener Aggression, wie sich aktuell mehr als deutlich abzeichnet. Aktionen wie „Deutschland spricht“, in der sich politische Gegner persönlich begegnen, können zu einem solchen wechselseitigen Verständnis und einer Glättung emotional hochgeschaukelter Wogen beitragen. Natürlich sollten sich weltanschaulich divergierende Positionen im Rahmen der Menschenwürde und des Verfassungsbogens bewegen.
Die Band STS hat diese Herangehensweise in ihrem zeitlosen Klassiker „Großvater“ auf wunderbare Weise formuliert. Dem Enkel wurde hier der Großvater in der Rückschau zum entscheidenden Vorbild im eigenen Erwachsenwerden: „Du worst ka Übermensch, host a nie so tan, g'rod desweg'n wor da irgendwie a Kroft und durch die Ort, wie du dei Leb'n g'lebt host, hob i a Ahnung 'kriagt, wia ma's vielleicht schofft. Dei Grundsatz wor: „Z'erst überleg'n, a Meinung hob'n, dahinter steh'n“. Niemols Gewolt, olles bered'n, ober a ka Ongst vor irgendwem.“
Des Weiteren müssen wir weg vom Rassismus und Klassismus. In den Medien, aber auch in unserem eigenen Urteilen gibt es nicht selten Opfer erster, zweiter oder dritter Klasse, genauso wie Täter erster, zweiter oder dritter Klasse. Zum Ausdruck kommt dies in der klassischen, durchaus nachvollziehbaren, aber doch auch bedenklichen Phrase: „My country, right or wrong“. Unsere Empathie, auch das ist wiederum menschlich, ist eben nicht gerecht verteilt. Wir haben mehr oder weniger Mitleid mit Menschen, je nachdem, ob sie uns psychologisch oder kulturell näher oder ferner stehen. Die permanente mediale Berichterstattung über Kriege und Katastrophen tut ihr Übriges, um uns seelisch abstumpfen zu lassen. Was wäre, wenn alle Opfer auf gleiche Weise Opfer, wenn alle Täter auf gleiche Weise Täter wären?
Was wäre, wenn man womöglich noch über den Menschen hinter dem Opfer oder Täter berichten würde? Dann könnten die Medien aus Zeitgründen nichts mehr berichten, denn jede Berichterstattung ist zwangsläufig einseitig (agenda setting) und folgt einem bestimmten Narrativ, das die Nutzer unterschwellig in eine bestimmte Richtung lenkt. Uns fiele es bei voller Information um einiges schwerer, andere zu verurteilen, auch wenn nicht immer alles verstehen alles verzeihen heißt. Wir müssten uns jedenfalls mehr mit den eigenen Unzulänglichkeiten beschäftigen. Davon lassen wir uns nur allzu gerne durch Medien aller Art ablenken. Wer sich selbst jedoch genauer unter die Lupe nimmt und kennengelernt hat, nicht nur die eigene Schokoladenseite, sondern auch Abgründe in sich: Gier, Neid, Gefallsucht, der wird andere Menschen automatisch differenzierter betrachten. Er wird versuchen, sie so zu sehen, wie Gott sie gemeint hat (Fjodor Dostojewski), was naturgemäß bei Schwerverbrechern ein anspruchsvolleres Unterfangen darstellt als bei umgänglichen Menschen.
Die Heiligen als menschliche Vorbilder
Aus der ehrlichen Selbstschau resultiert aber eine zentrale Einsicht: Es gibt weder den ausschließlich guten Israeliten noch den ausschließlich bösen Palästinenser, weder den allzeit guten Christen noch den allzeit bösen Muslim, weder den nur niederträchtigen Russen noch den nur anständigen Ukrainer, weder die immer empathisch-einfühlsame Frau noch den immer rücksichtslos und gefühlskalt auftretenden Mann. All das sind diskriminierende Stereotype, die überhaupt nicht weiterhelfen. Es gibt immer beides auf beiden Seiten und beides in jedem Menschen zugleich. Genau auf diesen Umstand wollte Viktor Frankl hinweisen, der aus diesem Grund die Kollektivschuldthese ablehnte. Alle Menschen sind im Prinzip Teil einer großen Familie, bilden eine Schicksalsgemeinschaft und gleichen einander in ihrem Grundwesen, auch wenn es natürlich deutlich voneinander abweichende familiär-kulturelle Prägungen gibt und unterschiedliche Reifegrade an Empathie, Bindungs-, Beziehungs-, Liebes- und Selbstreflexionsfähigkeit. Abgrundtief böse Menschen (z.B. Psychopathen, Sadisten) sind genauso selten wie vollkommen lichte Heiligengestalten, ja die Hagiographien, die Heilige als von Kind auf in all ihrem Denken und Handeln verklären, in denen das Weihrauchfass schon bei der Geburt geschwenkt wird, sind unbedingt abzulehnen.
Gefragt sind Psychobiographien, in denen das Ringen dieser Menschen um Selbstvervollkommnung, ihr Umgang mit Ängsten und Zweifeln, mit Leid und Enttäuschung in ihrem Leben auf so realistische Weise wie nur möglich dargestellt wird. Nur dann können sie für uns zu Vorbildern werden, indem wir erkennen, dass sie Menschen wie wir waren.
Übermenschen kann niemand nacheifern. Allgemein helfen Humor und Gelassenheit, Liebe und Geduld bei der Selbstentwicklung (und der Erziehung von Kindern). Ein Heiliger, der Geduld und Nachsicht auf besondere Weise gelehrt und gelebt hat, war Franz von Sales. Von ihm stammt der Ausspruch: „Habe Geduld in allen Dingen, vor allem aber mit dir selbst!“ Aber auch er musste sich diese Geduld mühsam aneignen, speziell durch den Umgang mit schwierigen Menschen in seiner Umgebung. Humor hat auf besondere Weise der heilige Philipp Neri gelebt. Sein Motto lautete: „Das Gewöhnliche ungewöhnlich gut tun und dabei fröhlich bleiben.“
Auch als Beichtvater war er unkonventionell. Berühmt ist die Anekdote der Buße, die er der Contessa Bianchi auferlegte. „Die vornehme Frau beichtete bei Philipp, dass sie immer wieder Schlechtes über Mitmenschen gesprochen habe. Zur Buße schickte er sie auf den Markt, sie solle ein Huhn kaufen und zu ihm bringen, es auf dem Weg aber sorgfältig rupfen. Schon am nächsten Tag kam die Frau mit dem völlig federlosen Tier und bekam nun die Aufgabe, die unterwegs verstreuten Federn einzusammeln; empört wies die Dame darauf hin, das sei unmöglich, der Wind habe die Federn inzwischen über ganz Rom verteilt.
"Das hättest Du vorher bedenken müssen", antwortete Philipp, "denn so wie du die Federn nicht wieder aufsammeln kannst, so kannst du auch die einmal ausgesprochenen bösen Worte nicht wieder zurücknehmen" (heiligenlexikon.de, Stand: 10.06.2024). Dies erinnert an den weltberühmten Gedanken, der von Charles Reade verbreitet wurde (und häufig, wiederum fälschlich, dem Talmud zugeschrieben wird): „Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte; achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen; achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten; achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter; achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.“
Und schließlich sollten wir uns besonders als Christen darum bemühen, nach Unvoreingenommenheit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit zu streben, Verzichtbereitschaft zu entwickeln – sowohl materiell als auch hinsichtlich der Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit, und konkrete Barmherzigkeit und Wertschätzung im Alltag zu üben, indem wir zum Beispiel in Gesprächen aufmerksam und präsent sind, uns also nicht in Gedanken bereits im nächsten Meeting befinden. Das klingt banal, ist es aber nicht, denn gutes Zuhören wird in der Schule nicht gelehrt, obwohl es in jeder zwischenmenschlichen Beziehung essentiell ist. Generell sollten wir uns mehr um das kümmern, was sich in unserem eigenen Leben und Umfeld in kleinen Schritten zum Positiven ändern lässt, weniger um die Rettung der Menschheit, des Erdklimas oder die Kommentierung aller nur erdenklichen Beiträge im Internet – denn das ist wohlfeil, es fordert nichts von uns und erspart uns die womöglich anstrengende Begegnung mit einem echten Gegenüber. Virtuelle Spiegelfechterei ist halt etwas anderes als ein realer Fechtkampf.
Ich weiß, viele von den gerade geäußerten Hinweisen klingen relativ abstrakt, teilweise utopisch. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass der Wandel nicht von Systemen, auch nicht von der inzwischen fast schon wie ein Heilsbringer und Götze verehrten KI ausgeht, sondern von uns selbst, von jedem einzelnen Menschen, denn nach Erich Kästner gibt es nichts Gutes, außer man tut es. Jede gute Tat gleicht einem Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Vielleicht bedankt sich unser Gegenüber nicht für die ihm erwiesene gute Tat, aber indirekt wirkt sie womöglich doch weiter, indem das Gegenüber wiederum andere Menschen, mit denen es Kontakt hat, besser behandelt.
Als Christen müssen wir dabei auch den Mut aufbringen, gegen den Strom zu schwimmen. Zeitlos ist in dieser Hinsicht das Gedicht von Lothar Zenetti: „Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner ja sagt, sollt ihr‘s sagen. Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht.“
Scheidung der Geister als Teil des Christentums
Zum Schluss dieses wieder etwas länger als geplant geratenen Essays ist im Zusammenhang mit dem Oberthema der gesellschaftlichen Spaltung auch auf das im Christentum selbst angelegte Element der Spaltung, der Scheidung der Geister einzugehen, indem man sich für oder wider Christus und seine Lehre entscheiden kann. Entscheidet man sich bewusst für Christus, so hat dies Konsequenzen, speziell in einem immer säkularisierter werdenden Umfeld, in dem viele Menschen den Glauben als unwissenschaftlich verspotten und kaum mehr ein Schuldbewusstsein im traditionell kirchlichen Sinne besitzen.
Wir sollten als Christen sehr behutsam im Urteil über andere sein, denn so wie wir urteilen, werden auch wir schließlich beurteilt. Außerdem sollten wir mehr auf den Balken im eigenen Auge, als auf den Splitter im Auge des Nächsten achten (Mt. 7, 2-3). Zugleich haben wir aber die Pflicht und sollten hierzu auch den Mut aufbringen, die Sünde der Mitmenschen als Sünde zu benennen, den Sünder zunächst unter vier Augen, dann unter Zeugen und schließlich in der Gemeinde auf sein begangenes Unrecht aufmerksam zu machen (Mt. 18, 15-17). Noch schärfer ist dies im Alten Testament formuliert: „Wenn ich zum Gottlosen sage: Du musst sterben!, und du gibst diese Warnung nicht an ihn weiter und redest nicht mit ihm, um ihn von seinen bösen Taten abzubringen, damit er am Leben bleibt, dann wird er wegen seiner Sünde sterben, doch ich werde dich für seinen Tod zur Verantwortung ziehen.
Wenn du ihn aber warnst und er sich trotzdem nicht von seiner Gottlosigkeit und seinem schlimmen Lebenswandel abbringen lässt, dann wird er wegen seinen Sünden sterben, während du dein Leben gerettet hast“ (Ezechiel 3, 18-19).
Es sollte klar sein, dass man als Christ dadurch zwangsläufig mit der Umwelt anecken und, wenn man die obige Aufforderung wirklich ernst nimmt, auf erheblichen Widerstand stoßen wird, vor allem bei rein nach weltlichen Vergnügen und Macht strebenden Menschen. Auch „klare Kante“ bei strittigen Fragen wie Abtreibung, Homosexualität, Menschenbild (Erbsünde) oder Sterbehilfe führt oft zu erheblichem Unmut auf der Gegenseite. Butterweiche Konfliktvermeidung und Harmoniesucht (people pleasing) können aber keine ernst zu nehmende Alternative sein.
Es allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Noch weniger können dies Christen erreichen, die sich auf geoffenbarte göttliche Gebote als Leitplanken ihres Handelns und Urteilens stützen und deren oberstes Ziel es sein muss, Gott zu gefallen, nicht aber den Menschen, dem Heiligen Geist zu dienen, nicht aber dem Zeitgeist. Uns muss bei allem Bemühen um den Abbau von Ausgrenzung, bei allen Versuchen, zu versöhnen, statt zu spalten, wie es der ehemalige deutsche Bundespräsident Johannes Rau formuliert hat, bei allem Streben, Brücken zu bauen und gesellschaftliche Gräben zuzuschütten, bewusst bleiben, dass vollkommener Frieden in einer Gesellschaft nie hergestellt werden kann. Ja, Unfrieden und Spaltung gehen wie ein Schwert bis in die Familien hinein, wie Jesus prophezeite: „Denn von nun an wird es so sein: Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen: Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei, der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter“ (Lukas 12, 53-53).
Der Zustand der vollkommenen Nichtdiskriminierung ist sowieso eine Utopie, nicht zuletzt, weil Gerechtigkeit ein höchst subjektives Phänomen darstellt. Irgendwer wird sich immer entrüstet, vor den Kopf gestoßen oder auf den Schlips getreten fühlen. Jesus Christus ist zwar prinzipiell für alle Menschen gestorben, gerettet werden aber nur die, die guten Willens sind, die Christus vor den Menschen bekennen, sein Kreuz auf sich nehmen und ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt (Kol. 1, 24), die dem Willen des Vaters folgen, seine Gebote erfüllen und den steilen, schmalen Pfad zum Reich Gottes, nicht aber die breite und bequeme Hauptstraße der Welt wählen, die also den Kreuzweg gehen, nicht dem Weg rein irdischer Vergnügungen folgen (wie es auf dem berühmten Bild „Der breite und der schmale Weg“ von Charlotte Reihlen dargestellt ist).
Die Spaltung in uns selbst überwinden
Überdies muss es unser erstes Anliegen sein, die Spaltung in uns selbst zu überwinden, den Spalt zwischen dem, was uns zum Bösen drängt, und dem, was uns vom Guten abhält, zu schließen, das eigene Seelenheil fest im Blick zu behalten, der Selbstvervollkommnung aus dem Zentrum der Gottesliebe und in der liebevollen Begegnung mit unserem Nächsten Tag für Tag ein kleines Stückchen näher zu kommen. Neben der Arbeit an sich selbst und dem geistigen Bemühen um Heiligung steht uns Katholiken im Falle des unvermeidbaren Scheitern, aus dem aber die so wichtige Frucht der Demut erwächst, der einmalige und unermeßliche Schatz der Beichte – das Sakrament der Versöhnung – zur Verfügung.
Bei echter Reue und dem festen Vorsatz, sich entschlossen von jeder Anhänglichkeit an die Sünde abzuwenden – um beide geistigen Gaben sollten wir beten – vermag die Beichte laut Pater Pio den erkalteten Stern wieder zum Glühen zu bringen; sie versetzt uns zurück in den Stand der heiligmachenden Gnade. Die Beichte macht leicht! Mögen alle Katholiken diesen himmlischen Schatz, der das geknickte Rohr wieder aufrichtet, den glimmenden Docht wieder entflammt (Jes. 42, 3), neu für sich entdecken, ist doch mit ihr das eigentliche Herz der Kirche – die Eucharistie – unverbrüchlich verbunden. Wenn die Beichtpraxis in der Kirche wieder auflebt, wird auch die eucharistische Anbetung wieder brennen und die innerkirchliche Spaltung abnehmen, wird der Rauch Satans weichen müssen.
Die Eucharistie ist das pulsierende Herz Jesu, aus dessen Seitenwunde der immerwährende, belebende und heilsbringende Gnadenquell sprudelt. Nur die katholische Kirche begeht das unblutige Opfer der heiligen Messe. Es ist ihr Alleinstellungsmerkmal, lässt sie herausragen aus allen anderen christlichen Gemeinschaften. Nicht ohne Grund wurde die Kirche über Jahrhunderte als die alleinseligmachende bezeichnet, doch wurde dies aus Rücksichtnahme vor zu scharfer Abgrenzung gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften zuletzt abgeschwächt, wenn auch nie gänzlich verworfen (vgl. die Erklärung Dominus Iesus unter Johannes Paul II. aus dem Jahr 2000). Denn die Lanze des Hauptmanns durchbohrte das Herz des Gekreuzigten und aus der Wunde strömte Blut (= Mensch) und Wasser (= Gott); zusammen ergibt dies: ganz Mensch und ganz Gott (so wie das Kreuz als Heilssymbol auf die horizontale, irdisch-vergängliche (labora) und die vertikale, himmlisch-unvergängliche Dimension (ora) verweist). „Wahrhaftig, das war Gottes Sohn!“ (Mt. 27, 54), so die bekennenden Worte des Hauptmanns.
Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.
kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)
kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. | 
Mehr zu | 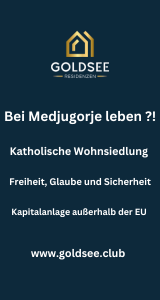





Top-15meist-gelesen- Gänswein zum Apostolischen Nuntius für Litauen, Estland und Lettland ernannt!
- Bischof Voderholzer untersagt Priesterweihen in Zaitzkofen
- Zölibat in der frühen Kirche? Rezension zu „Andreas Wollbold: Zölibat“
- Wenn "KHG-Katholiken" in Tübingen andere Christen diffamieren
- Vigano de facto bereits im Schisma
- Rückt etwas zusammen - es wird kälter in Deutschland
- 'DANKE, HERR', dann starb Pater Gaston Hurtubise
- Deutsche Kirchenstatistik 2023: 20 Mill. 'Katholiken', aber nur 1,26 Mill. besuchen die Hl. Messe
- Ex-Journalist und Franziskaner Moritz Windegger von Bischof Muser in Bozen zum Priester geweiht
- Game over für BIDEN? - Trump ante portas!
- "Als fünffacher Vater mit kleinen Kindern ist das für mich mehr als ärgerlich und nicht akzeptabel"
- Vatikan fordert erneut Änderungen beim Synodalen Weg in Deutschland - Schluss mit 'Synodaler Rat'
- Vatikan: Rupnik-Bilder-Streit eskaliert - Kardinal O'Malley hat genug!
- 'Meine lieben Kinder, der Friede ist in Gefahr und die Familie steht unter Angriff'
- Papst Franziskus empfängt Prior einer Gemeinschaft, die die außerordentliche Form pflegt
|