 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:   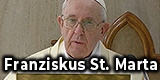  Top-15meist-diskutiert
|  Religionsunterricht vernebelt den Glauben17. April 2018 in Kommentar, 26 Lesermeinungen Paulus lehrte die Auferweckung Christi als Angelpunkt des Glaubens, doch was macht der katholische Religionsunterricht daraus? Gastkommentar von Gabriele Freudenberger Limburg (kath.net) Ewiges Leben aber wie? So lautete der Titel eines Studientages am 7. 2. 2018 im Wilhelm-Kempf-Haus Wiesbaden-Naurod des Bistums Limburg. 60 Religionslehrer/innen beider Konfessionen waren der Einladung gefolgt. Als Referentin für die Fortbildungstagung fungierte Dr. Theresa Schwarzkopf vom Institut für katholische Theologie in Paderborn. Im christlichen Kontext ist die Frage nach dem ewigen Leben untrennbar mit der Auferstehung verbunden. Auf dieses Themenfeld konzentrierte sich dann auch die Theologin, ohne auf die biblischen Lehren einzugehen etwa die des Apostels Paulus. Paulus lehrte die Auferweckung Christi als Angelpunkt des Glaubens: Wie gesagt, spielte diese biblische Glaubensbasis bei dem Studientag keine Rolle. Auch das didaktische Vorgehen des Paulus wurde nicht aufgegriffen, obwohl es ein passender Anknüpfungspunkt für heutige Religionspädagogik wäre. Auferstehung nur eine offene Symbolvorstellung? Nach dem Lehrgangsbericht auf der Limburger Bistumsseite drehten sich alle Fragen und pädagogischen Hinweise allein um die Auferstehungsvorstellungen der Teilnehmer und zwar in der ganzen Bandbreite. Für die Lehrpersonen habe sich der religionspädagogische Reflexionsprozess darauf zu konzentrieren, sich seiner eigenen Vorstellungen von Auferstehung zu vergewissern. Auch Zweifeln daran und Ängste sollten zugelassen und Ernst genommen werden. Die Darstellung dieser Haltung trüge zu einem authentischen Auftreten vor den Schülern bei. Die christliche Auferstehung deutete die theologische Referentin der Tagung als ein Symbol, das in Mehrperspektivität zu entfalten sei. Die verschiedenen Vorstellungs-Begriffe dürften offen gedacht werden insbesondere im Horizont neuer Welterfahrungen wie etwa der Digitalisierung. Als Zwischenergebnis ist eine doppelte Relativierung festzustellen: ▪ Dieses Symbol soll jeder Religionslehrer in diversen Perspektiven und Vorstellungen weiterentwickeln und anreichern. Dieses Oszillieren zwischen subjektiven Auferstehungsvorstellungen wurde dann auf den religionspädagogischen Vermittlungsprozess übertragen. So sollen die Schüler ermuntert werden, ihre eigenen Phantasievorstellungen von Auferstehung und Himmel zu entwickeln. Als Beispiel nannte die Referentin die Schüleräußerung: Mitten im Leben Mut für einen neuen Lebensabschnitt fassen. Mit dieser Vorstellung wird der biblisch-kirchliche Glauben an die Auferweckung der Toten verwandelt in eine Ermutigung für ein selbstbestimmtes Aufstehen im Verlauf des Lebens. Die Referentin ermahnte, solche Artikulationen nicht auf den Wahrheitsgehalt zu befragen, ob sie etwa mit den biblischen Aussagen übereinstimmten. Überhaupt hätte die Religionspädagogik nicht darauf hinzuarbeiten, den Schülern die biblisch-kirchliche Lehre zu erklären oder sie gar zum christlichen Glauben zu führen. Das Lernziel des Religionsunterrichts sollte allein darin bestehen, die Schüler zu einem Reflexionsprozess über ihre eigenen Vorstellungen anzuregen. Dabei könnten sie lernen, die Stimmigkeit ihrer Positionen zu verbessern, sie neu und detaillierter zu denken, damit sie in der Diskussion mit anderen für ihre Symbolvorstellungen argumentieren und einstehen könnten. Das Ergebnis der vorgestellten Art von Religionspädagogik besteht demnach darin: ▪ Die religionspädagogischen Lernbegleiter hätten sich darauf zu beschränken, mit Impulsen zu den als offen definierten Symbolbegriffen aus Bibel und Kirche wie etwa Auferstehung - die Vorstellungswelt der Schüler zu inspirieren und sie anzuregen, ihre eigenen Positionen durch Selbstreflexion stimmig zu machen. ▪ Alle Vorstellungen der Schüler seien als legitim anzuerkennen als Äußerungen im Prozess der Selbstklärung. In diesem schülerzentrierten Rahmen sollten selbstverständlich Differenzen in der katholischen und protestantischen Glaubenslehren als irrelevant angesehen werden. Religionsunterricht als Etikettenschwindel für Lebenskunde Wenn gläubige Eltern erstmals explizit mit dieser Ausrichtung der Religionspädagogik konfrontiert werden, sind sie geschockt: Das ist doch kein Religionsunterricht mehr, sondern ein Etikettenschwindel für selbstbezogene Lebenskunde. Dafür spricht, dass Bibel und Kirche, Jesus Christus und dreifaltiger Gott, Credo und Gottesdienst nur noch als Symbolworte eingeführt werden, die im Prozess der Selbstverwirklichung in subjektiven Vorstellungen weiter ausgedeutet werden. Aber steht eine solche Religionspädagogik nicht im Widerspruch zur kirchlichen Beauftragung (missio canonica), nach der die Kerninhalte des christlichen Glaubens zu vermitteln sind? Weiß denn der Bischof darüber Bescheid, wie vor den Schülern lehrplanmäßig der biblisch fundierte und kirchlich tradierte Glauben relativiert, reduziert und schließlich verdunstet wird? Tatsächlich schauen die deutschen Bischöfe seit 40 Jahren dabei zu, wie Theologen und Pädagogen den katholischen Religionsunterricht entkernen und verkehren. Die Oberhirten geben ihren Segen dazu, indem sie solcherart Lehrpläne und Lehrbücher genehmigen und entsprechende Fortbildungen unterstützen wie oben gezeigt. Die bis heute gültigen Leitlinien für die schulische Religionslehre wurden 1974 auf der Würzburger Synode aufgestellt. Die Kirchenversammlung in der Zeit des progressiven Aufbruchs legte damals fest: Das Ziel der katholischen Religionslehre soll ausdrücklich nicht die Vermittlung von Glaubenswahrheiten der Kirche sein. Die Schüler dürften in ihrer Spontaneität nicht auf Antworten des katholischen Glaubens eingeengt werden. Das positive Lernziel des Religionsunterrichts bestand laut Synodenbeschluss darin, den Kindern und Jugendlichen zur Selbstwerdung zu verhelfen. Dieses Ziel sollte den Schülern anhand menschlicher Erfahrungen wie Liebe und Glück sowie den sozialen und politischen Dimensionen der Welt erschlossen werden. Man erkennt deutlich, dass die eingangs skizzierte Tagung auf den Leitlinien der Würzburger Synode von 1974 weiterarbeitet. Das Synodenpapier zum Religionsunterricht hatte einen umstürzenden Paradigmenwechsel eingeleitet: Der katholisch-konfessionelle Religionsunterricht sollte nicht mehr der pädagogisch aufbereitete Vermittlungsprozess vom unverkürzten Glaubensgut und dem Leben der Kirche sein (Katechese), sondern allein pädagogisch legitimiert werden aus den Erfahrungen des modernen d. h. zeitgeistigen Menschseins, um zu einer reflektierten Lebensbewältigung zu kommen. Unter dieser Rahmenzielsetzung sollten biblische und kirchliche Traditionen einbezogen werden, aber eben nur als nützliche Anregungen auf dem Weg zur Selbstwerdung. Ein Blick auf den Lehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I in Hessen bestätigt die Kontinuität mit den Würzburger Richtlinien. Dabei ergibt sich das Paradox, dass bei der Zielsetzung des katholischen Religionsunterrichts die Orientierung auf christliche Inhalte und Bekenntnisse keine Rolle spielt. Denn für das Hauptlernziel der Identitätsfindung und Lebensbewältigung junger Menschen werden andere Themen in den Vordergrund gerückt wie Begegnung mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit Natur und Schöpfung sowie mit anderen Religionen und Weltdeutungen. Damit sind drei der fünf Themenfelder bzw. Lernbereiche des Lehrplans vorgegeben. Nachgeordnet werden die beiden Begegnungsfelder zur biblische Botschaft und der Kirche. Aber auch diese Themenbereiche sollen unter dem obersten Lernziel der Selbstverwirklichung behandelt werden. Auferstehung als Lebenskunst? An einem Unterrichtswerk kann die Konzeption erläutert werden, wie man die Evangeliumsschriften nutzt, um mit lebensrelevanten Interpretationen die Identitätsfindung von Jugendlichen zu fördern: Die biblische Geschichte wird bei diesem Vorgehen zu einem Aufhänger degradiert, um solche Themenkomplexe wie Sozialisation und Identitätsentwicklung im Kontext heutiger Zeit zu behandeln. Im Nachhinein muss den Schülern die Beschäftigung mit dem biblischen Text wie ein überflüssiger Einstieg vorkommen. Auch die Religionslehrer selbst machen sich mit der genannten Themenableitung überflüssig, denn für solche fachfremden Lehrgegenstände wie moderne Geschichten und Lyrik sind Deutschlehrer besser qualifiziert. Die Kehrseite dieser religionspädagogischen Ausflucht in heutige Identitätsprozesse besteht darin, dass die theologischen Kernaussagen der hl. Schrift auf der Strecke bleiben. Das sind in diesem Fall die Erörterung von Krankheit und Tod als Folge der Erbsünde oder die Darstellung der Person Jesu Christi als Erlöser von Sünde und Tod. Ebensowenig werden die Auferweckungswunder Christi als göttliche Vollmachtszeichen für die zukünftige Auferstehung der Toten erschlossen, wie die Evangelisten selbst die Taten Jesu gedeutet haben. Und damit schließt sich der Gedankenkreis zu der oben aufgeführten Fortbildungsveranstaltung: Auch nach dem hessischen Lehrplan soll der Credo-Glaubenssatz von der Auferstehung der Toten in eine Auferstehung der Lebenden verkehrt werden. Die Kernbotschaft des biblisch-kirchlichen Glaubens wird dadurch zu Ratschlägen der Lebenshilfe banalisiert nach der Art: Auferstehung als Lebenskunst, Aufstehen als Lebensprinzip beides Zitate aus dem Mittelstufenlehrplan katholische Religionslehre, von den Bischöfen aus Fulda, Limburg und Mainz approbiert. Als Resümee des Dargestellten bleibt festzuhalten: ▪ In einem katholischen Religionsunterricht, der sich streng am Lehrplan orientiert, werden die biblischen Glaubensereignisse in vage symbolische Vorstellungen verflüchtigt, um sie für die subjektive Identitätsfindung passend zu machen. ▪ Zehn oder 13 Jahre schulischer Unterricht unter dem Etikett Religionslehre zur Selbstfindung führt katholische Kinder und Jugendlichen sukzessive von der biblisch-kirchlichen Glaubenslehre weg. Was Bischöfe als Verdunstung des Glaubenswissens beklagen, ist in Wirklichkeit eine Verneblung der christlichen Lehre schon bei der Katechese von Kindern und Jugendlichen. ▪ Die religionsunterrichtliche Umdeutung aller religiös-sakralen Handlungen und Weisungen sowie Transzendenzbeziehungen in einen anthropologischen Immanenzrahmen entfremdet die heranwachsenden Katholiken von dem kirchlich-gemeinschaftlichen Vollzug des Glaubens in Sakramenten und Liturgie, Kirchenjahr und Kirchenfesten. Es kommt immer wieder vor, dass gläubige Eltern ihre Kinder von hyperkritischem Religionsunterricht abmelden, damit sie nicht gänzlich vom biblisch-kirchlichen Glaubensvollzug weggeführt werden. Steht es wirklich so schlimm mit dem Religionsunterricht? Ja wie man an den Folgewirkungen ersehen kann: Wenn Schülern die Auferstehung als Lebenskunst oder Ermutigung zu jeweils neuem Aufstehen nahe gebracht wird, werden sie kein Verständnis mehr aufbringen für die Lesungen und Liturgien, Sakramentalien und Segenshandlungen der Osternacht. Gleichwohl sind auch Lichtblicke zu melden. Es gibt sie noch, die gläubigen Religionslehrer/innen, die Schüler für ein christliches Glaubensleben überzeugen und begeistern können. Mit oder gegen den Lehrplan führen sie in die authentische christliche Lehre und kirchliche Glaubensvollzüge ein. Ein weiterer Lichtblick war die Schrift der DBK von 2005: Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen. Der Text führte einen neuen Ansatz ein: Statt Identitätsfindung setzte man als Lernziel des RU die schülergerechte Vermittlung von Glaubenswissen und Kenntnissen zum Ganzen des kath. Glaubens an. Auch die Einübung in Glaubensvollzüge wie das Kreuzzeichen und die Grundgebete wurde empfohlen. Doch die Reform-Ansätze wurden dadurch konterkariert und letztlich sabotiert, indem man das Dokument explizit zur Fortschreibung des Synodenpapiers erklärte. Jede Gruppe kann aus diesem ambivalenten Papier seine Tendenz herauslesen: Kurskorrektur oder eben Weiter so mit dem Synodentext. Im Ergebnis wirken sich die widersprüchlichen Signale so aus, dass sich auch dreizehn Jahre nach dem DBK-Papier an der Ausrichtung des Religionsunterrichts wenig bis nichts geändert hat. Ein Bischof schrieb: Für unser Bistum bleiben die Beschlüsse der Würzburger Synode ( ) zum Religionsunterricht auch zukünftig bindend. Aus solcher Orientierung wird erklärlich, dass in diesen wie in anderen Bistümern von Seiten der Schulämter nicht auf eine Kurskorrektur in der Unterrichtspraxis gedrungen wird. Die Lehrerfortbildungen werden nicht am Papier von 2005 orientiert, wie oben gezeigt. Die Lehrpläne sind weiterhin am Synodenpapier ausgerichtet. Was ist zu tun? An erster Stelle ist die Deutsche Bischofskonferenz gefordert, ihre widersprüchliche Haltung zur Reform des RU aufzugeben. Nur bei einer kritischen Verabschiedung vom überholten Synodenpapier hat die Kurskorrektur eine Chance. Die Bischöfe sind in ihren Bistümern voll verantwortlich dafür, ob der Religionsunterricht weiterhin nach dem glaubensvernebelnden Modell der Würzburger Synode gegeben oder eine glaubenstreue Richtung eingeschlagen wird. Die Bischöfe haben dazu den Auftrag wie auch die Mittel. In ihren Schulabteilungen arbeitet das Personal, das auf Weisung des Bischofs eine Kurskorrektur einleiten könnte. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuReligionsunterricht
| 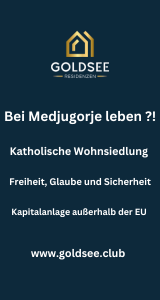      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||

